Studien und Publikationen zu KI
Stand September 2025
Hier finden Sie studienbasierte Antworten auf häufige Fragen von Lehrpersonen zur Verwendung von KI.
Der UNESCO-Bericht AI and the future of education: Disruptions, dilemmas and directions ist eine tiefgehende Auseinandersetzung mit 21 Beiträgen zu philosophischen, ethischen und pädagogischen Implikationen, die durch die Anwendung von KI entstehen.
Die folgende handlungsorientierte Zusammenfassung für Lehrpersonen und Schulen fokussiert gezielt auf die pädagogische Praxis.
Chancen von KI
- Personalisierte Unterstützung von SuS/Lernenden und adaptives Feedback sind möglich
- Lehrpersonen werden bei der Unterrichtsvorbereitung und der Differenzierung von Lernangeboten unterstützt
- KI hat das Potenzial, bisherige Prüfungssysteme zu erneuern
Herausforderungen und Risiken von KI
- Es kommt zu einer Bewertungskrise: Summative Prüfungen sind nicht mehr wie bisher durchführbar
- Zugang zu KI muss chancengereicht verteilt sein
- Ethische Probleme durch Datenschutz, Bias und kommerzielle Kontrolle
- Kognitives Risiko: Eine "Übernutzung/starke Konsumhaltung" von KI kann kritisches Denken und Kreativität schwächen. KI soll unterstützen und das Denken nicht ersetzen
Rolle der Lehrpersonen
- Lehrpersonen bleiben das Herzstück der Bildung – KI soll unterstützen, nicht ersetzen
- Lehrpersonen sollen als bewusste Gestalter KI-gestützter Lernprozesse auftreten
- Lehrpersonen müssen von Schulen in KI-Kompetenz und ethischem Einsatz geschult werden
- Lehrpersonen sind einer "Ethik der Fürsorge" bei Gestaltung und Einsatz von KI verpflichtet
Handlungsaufträge für Lehrpersonen und Schulen
- Lehrpersonen und Schulen müssen dringend Bewertung und Pädagogik im Licht von KI neu gestalten
- Generative KI untergräbt traditionelle Prüfungsformen, deshalb sollten Lehrpersonen auf prozessorientierte, kreative und kollaborative Bewertungsformen setzen
- gleichzeitig sollen SuS/Lernenden KI-Kompetenz und ethisches Bewusstsein vermittelt werden
Lehrpersonen sollten
- mit projektbasierten, mündlichen und kollaborativen Prüfungsformaten experimentieren
- SuS/Lernende im kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit KI schulen
- Kreativität, Zusammenarbeit und kritisches Denken fördern
Schulen sollten
- Fortbildungen zu KI-Werkzeugen und Ethik anbieten
- Gerechten Zugang zu KI-Ressourcen und Infrastruktur sicherstellen
- Fortbildungen zu KI-Werkzeugen und Ethik anbieten
Künstliche Intelligenz (KI) birgt ein enormes Potenzial, das Lernen grundlegend zu verbessern. Doch jenseits des anfänglichen Enthusiasmus ist ein systematischer und evidenzbasierter Ansatz entscheidend, um die tatsächlichen Auswirkungen von KI zu verstehen und ihr Potenzial voll auszuschöpfen.
Die Publikation "Looking Beyond the Hype: Understanding the Effects of AI on Learning" von Bauer et al., erschienen Ende April 2025 im Educational Psychology Review, stellt das innovative ISAR-Modell vor, das vier zentrale Arten von KI-Effekten im Lernprozess beleuchtet:
- Inversion (Umkehrung): Wie KI unbeabsichtigt zu einer Reduzierung des kognitiven Engagements und schlechteren Lernergebnissen führen kann – und wie dies vermieden wird
- Substitution (Ersetzung): Wenn KI traditionelle Unterrichtsansätze ersetzt und dabei Effizienz und Ressourcennutzung der Lehrpersonen optimiert, ohne die Lernprozesse der SuS/Lernenden direkt zu verändern
- Augmentation (Ergänzung): Wie KI den Unterricht durch zusätzliche, oft personalisierte kognitive Unterstützung bereichern kann, etwa durch besseres Feedback und adaptives Scaffolding
- Redefinition (Neugestaltung): Das transformative Potenzial der KI, Lernaufgaben so neu zu gestalten, dass sie tiefgreifende Lernprozesse (konstruktives oder interaktives Lernen) fördern, die zuvor nicht umsetzbar waren
Die Publikation unterstreicht, dass der Erfolg der KI-Integration massgeblich von der didaktischen Umsetzung, der KI-Kompetenz der SuS/Lernenden und den technologisch-pädagogischen Fähigkeiten der Lehrpersonen abhängt.
Entdecken Sie die konkreten Handlungsempfehlungen für Lehrpersonen bei der Umsetzung von KI im Unterricht.
Der Einfluss von KI auf das Lehren und Lernen an Hochschulen
KI hat einen erheblichen und vielschichtigen Einfluss auf das Lehren und Lernen im Hochschulbereich. KI ist nicht nur ein Werkzeug, das in Lehr- und Lernprozesse integriert werden kann, sondern auch weitreichende Auswirkungen auf die Kognition der Studierenden, die Verwaltung von Bildungseinrichtungen, die Bewertung und Dokumentation von Leistungen, die notwendigen Fähigkeiten der Lehrenden und die grundlegende Rolle der Hochschulbildung in der Gesellschaft hat. Die Bewältigung dieser Einflüsse erfordert proaktive Massnahmen bei der Entwicklung von Richtlinien, der Weiterbildung und der Anpassung von Lehrpraktiken und Lehrplänen
- KI-Werkzeuge für Lehren und Lernen
KI-Tools haben das Potenzial, einige der wirksamsten Technologien für die Zukunft der Hochschulbildung zu sein. Sie können personalisiertes Lernen skalieren, was lange eine Herausforderung für Institutionen war, die über eine "Einheitsgröße für alle"-Erfahrung hinausgehen wollten. "Agentic AI" könnte personalisierte Tutoren und Lehrassistenten bereitstellen. Institutionen und Lehrende stehen vor der doppelten Aufgabe, diese Tools zu nutzen, um Praktiken und Lernerfahrungen zu verbessern, und die Studierenden über diese Tools zu unterrichten. - Veränderung der Kognition von Studierenden
Technologie, einschließlich KI, verändert die Art und Weise, wie Studierende denken und lernen. Studien deuten darauf hin, dass häufiger Technologiegebrauch Aufmerksamkeitsspannen verkürzen, die Gedächtnisleistung reduzieren und kognitive Überlastung verursachen kann. Gleichzeitig können technologiegestützte Lernumgebungen Lernergebnisse verbessern, Studierende motivieren und zu tieferem Verständnis führen. Hochschulen müssen ihre Lehrpläne und Bewertungen an diese sich ändernden kognitiven Stile anpassen. - Neue Wege zur Dokumentation studentischen Lernens und Erfolgs
Fortschritte bei der KI könnten die Methoden zur Dokumentation studentischer Leistungen verändern oder neue schaffen. KI hat das Potenzial, die Dokumentation personalisierter, die Überprüfbarkeit (z.B. durch Automatisierung von Kompetenzbewertungen und Authentifizierung von Nachweisen) zu verbessern und die Dokumentation anpassbar zu gestalten, sodass Studierende ihre Aufzeichnungen in Echtzeit aktualisieren können. Bei der Implementierung von KI zur Nachverfolgung studentischen Erfolgs bleiben jedoch Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Datensicherheit und algorithmischer Voreingenommenheit bestehen. - Erhöhte Notwendigkeit der Fakultätsentwicklung für generative KI
Die schnelle Integration generativer KI-Tools erfordert neue Arten der Weiterbildung für Lehrende. Lehrende müssen lernen, wie sie diese Technologien verantwortungsvoll und ethisch nutzen und, was als kritisch angesehen wird, die Studierenden über die Risiken, Vorteile und den angemessenen Gebrauch von KI unterrichten können. Die Entwicklung sollte dabei die hohe Arbeitsbelastung und die sich schnell entwickelnde Natur der KI berücksichtigen. - Kritische Bedeutung von KI-Governance
Eine effektive KI-Governance wird als Voraussetzung für die Integration von KI-Tools und die Ermöglichung der Fakultätsentwicklung angesehen. Sie umfasst Prozesse, Richtlinien und Ziele, um ein Gleichgewicht zwischen innovativem Potenzial und akademischer Integrität, Datensicherheit und betrieblicher Effizienz zu finden. Die Schaffung und Aufrechterhaltung solcher Rahmenbedingungen ist eine Herausforderung, insbesondere angesichts der mangelnden oder ineffektiven Regulierung von KI auf breiterer Ebene. - Betonung der Kritischen Digitalen Kompetenz
Da generative KI das Erstellen digitaler Inhalte schneller und einfacher macht, wird die Kritische Digitale Kompetenz (Critical Digital Literacy) für alle Hochschul-Stakeholder noch wesentlicher. Dies geht über das technische Verständnis hinaus und beinhaltet die Fähigkeit, digitale Inhalte kritisch zu prüfen, zu beurteilen und zu interpretieren sowie verantwortungsbewusste Ersteller und Konsumenten digitaler Inhalte zu sein. - Gestaltung potenzieller Zukunftsszenarien
Die Entwicklung der KI ist ein zentraler Treiber in den vier diskutierten Zukunftsszenarien:
-
- Im Szenario Growth (Wachstum) führen schnelle KI-Fortschritte zu hyper-personalisierten Lernökosystemen.
- Im Szenario Constraint (Beschränkung) schreiben staatliche Vorschriften die Verwendung von KI-gestützten Analysen für die Entscheidungsfindung vor.
- Im Szenario Collapse (Zusammenbruch) führt die unregulierte Verbreitung von generativer KI zu einem Zusammenbruch des Wahrheitsbegriffs und untergräbt die Rolle der Hochschulbildung als vertrauenswürdige Quelle.
- Im Szenario Transformation (Transformation) wird KI-Kompetenz zu einer kritischen Fähigkeit im Rahmen eines auf Arbeitskräftebedarf ausgerichteten Bildungsmodells.
KI an europäischen Schulen - Vodafone Stiftung
Europäische Schülerbefragung zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz: Jugendliche sehen KI-Kompetenzen als entscheidend für die eigene berufliche Zukunft.
- Befragung der Vodafone Stiftung: 74 Prozent der jungen Menschen in Europa schätzen KI als eine entscheidende Fähigkeit für ihre berufliche Zukunft ein.
- Zwei Drittel halten den Zugang zu KI für wesentlich für ihren schulischen Erfolg.
- Mitschüler:innen (65 Prozent) sind die wichtigste Quelle für KI-bezogene Unterstützung, gefolgt von Eltern (60 Prozent) und Lehrkräften (50 Prozent).
- 46 Prozent aller befragten Schüler:innen fühlen sich durch ihre Schule ausreichend zur Nutzung von KI vorbereitet, 44 Prozent halten ihre Lehrkräfte für kompetent im Umgang mit KI.
Vodafone Stiftung, Januar 2025.
Die Publikation der Kultusministerkonferenz der deutschen Bundesländer beinhaltet themenspezifische Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz in schulischen Bildungsprozessen. In fünf Themenbereichen werden u.a. die Auswirkungen von KI auf Lernen und Didaktik und auf die Prüfungskultur beleuchtet. Weitere Kapitel sind der Professionalisierung von Lehrräften, der Regulierung und der Chancengerechtigkeit beim Zugang zu generativen KI-Anwendungen gewidmet. Die Empfehlungen, die jeden Themenbereich abschliessen, decken unterschiedliche Ebenen ab. Neben Anstössen für die Lehrerbildung, konkreten Vorschlägen für neue Prüfungsformate und Anpassungen in den betreffenden Rechtsrahmen wird die Teilhabe aller Lernenden an den neuen Schlüsselkompetenzen gefordert.
Die Publikation findet sich hier
.
KI in der Bildung
Die Fachagentur Educa hat im August 2024 in ihrem neuen Dossier eine Übersicht über KI-Systeme, die in der Bildung vorkommen, zusammengestellt. Thematisch geordnet wird nach folgenden Themenfeldern:
- Arten der künstlichen Intelligenz in der Bildung
- Anwendungsfelder: Bildung für KI - Bildung über KI - Bildung mit KI
- Anforderungen an Daten und Datennutzung in KI-Systemen
Im letzten Themenbereich gehen zwei Beiträge u.a. dem verantwortungsvollen Umgang mit KI und den rechtlichen Anforderungen zu KI im Bildungsram nach
KI in der Bildung Educa, 28.8.2024
Das Buch Es macht Klick: Künstliche Intelligenz bei schriftlichen Arbeiten clever nutzen von Sara Alloatti und Filomena Montemarano ist ganz nah am Unterricht und zwar bei den Lehrpersonen und den SuS/Lerndenden.
«Es macht klick» vermittelt Lernenden und Lehrpersonen grundlegende Kompetenzen im Umgang mit KI-Tools.
- Welche Werkzeuge sollen für welche Aufgaben gewählt werden?
- Wie formuliert man Aufträge an die KI?
- Und wie bewertet man die Antworten?
Im Kapitel "KI: Mein Buddy" laden zehn niederschwellige «Experimente» die SuS/Lernenden ein, KI-Schreibwerkzeuge anhand konkreter Aufgaben auszuprobieren.
Im Kapitel "KI: Dich steuere ich!" wird der Umgang mit der KI in zehn Lektionen reflektiert um eine eigene Haltung zu entwickeln.
Im Kapitel "KI: Wohin gehen wir?" werden sechs Gedankenexperimente durchgespielt, um Visionen zur Entwicklung der KI im Unterricht zu wagen.
«Es macht klick» eignet sich für vielfältige Unterrichtssettings auf Sekundarstufe II: im Fachunterricht, in fächerübergreifenden Themenwochen oder bei weiteren schriftlichen Arbeiten.
Telekom Leitfaden 2024
Künstliche Intelligenz in der Schule: Warum, wofür und wie? Sieben Technologien fürs Lernen, Lehren und Verwalten – leicht erklärt
Dieser Leitfaden ist die Kurzfassung einer Studie unter dem Titel „Schule und KI“, erstellt vom mmb Institut – Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung mbH und vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) für die Deutsche Telekom Stiftung.
Die komplette Studie findet sich hier.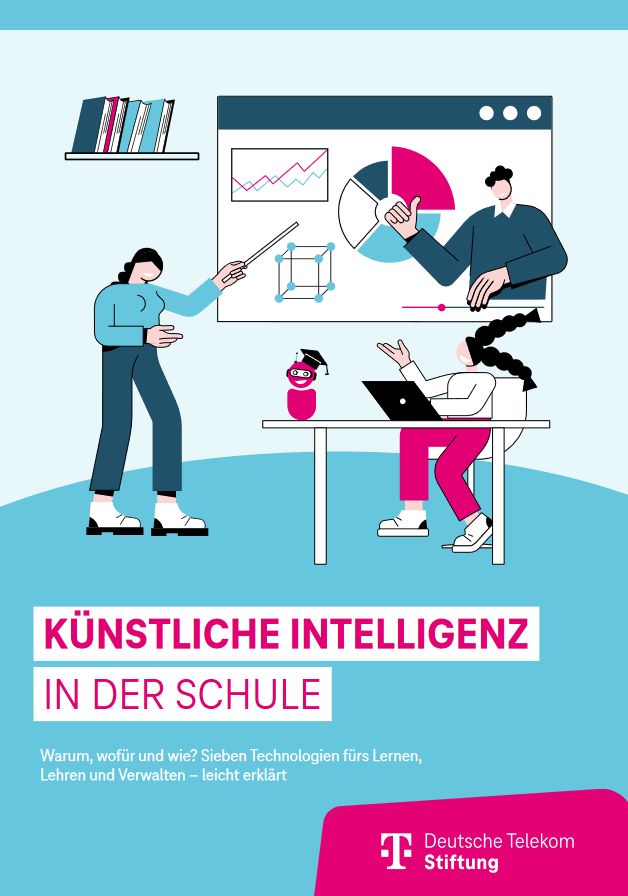
Pädagogik 3/2024 (Link zur Seite mit kostenpflichtigem Inhalt)
mit Beiträgen u.a. von Philippe Wampfler und Beat Döbeli Honegger
- KI ist in der Schule angekommen
Künstliche Intelligenz verspricht, in Zukunft zu einer Entlastung für das Lehren und Lernen zu werden - und auch heute ist schon vieles möglich. - Wie funktionieren ChatGPT und Co eigentlich?
Generative Modelle sind ein besonders innovativer Bereich der Kl. Wie funktionieren sie und worin liegt ihr Potenzial für die Schule? - Feedback und Schreibunterstützung durch Sprach-KI
Wie verändert Künstliche Intelligenz den Unterricht? Welche Rolle kann sie insbesondere bei der Verbesserung der Schreibfähigkeiten spielen? - Lernprozesse mit KI gestalten
Kl-Systeme können Lehrkräften bei der Gestaltung und Begleitung von Lernprozessen assistieren, indem sie den Schüler:innen z. B. Feedback geben. - »Darf's ein bisschen mehr sein?« - Entlastung durch KI
Inklusion und Integration fordern mehr individuelle Förderung bei immer größeren Klassen und immer weniger Lehrkräften. Kann KI hier helfen und entlasten? - Flut, Färbung und Fakes
Kl ist eine fundamentale medienpädagogische Herausforderung, z. B. beim Umgang mit Fälschungen. Wie lässt sich angemessen darauf reagieren? - Was will uns ChatGPT sagen?
Mit etwas Abstand zur ersten Aufregung nach der Veröffentlichung von ChatGPT & Co. stellt sich die Frage, was die neuen Möglichkeiten der KI für die Schule kurz- und längerfristig bedeuten.
Die Publikation (siehe weiter unten) der PH-Niederösterreich bietet auf 210 Seiten 32 Publikationen zum Thema "Künstliche Intelligenz" im Bildungsbereich.
Die 32 Zusammenfassungen bieten einen Überblick über die vielfältigen Themen und Perspektiven zur Nutzung von KI im Bildungskontext und helfen Ihnen, die für Ihre vertiefte Auseinandersetzung relevanten Publikationen zu identifizieren.
Positionspapier der UZH (Stand 09/2025)
Durch die Verbreitung von ChatGPT sind in jüngster Zeit die Fähigkeiten (generativer) Künstlicher Intelligenz (KI) in den Fokus der öffentlichen Debatte geraten. Das Strategy Lab «KI in Bildung, Forschung und Innovation - was verlieren wir, was gewinnen wir?» nimmt diese öffentlichen Diskussionen zum Anlass, vertiefend über die Chancen und Risiken von KI in einem für die Universitäten bedeutsamen Kontext nachzudenken: dem Bereich der Hochschul-/Berufsbildung, Forschung und Innovation - also dem Spektrum, das gemeinhin durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) abgedeckt wird.
News zum Thema KI
Unter der Rubrik "Wissen" führt SRF eine Themenseite zu Künstlicher Intelligenz, worin laufend neue Beiträge publiziert werden. Im Rahmen einer Themenwoche Ende November 2024 mit dem Titel "KI und wir" (17. -24.11.2024) wurde Fragen wie "Was kann KI wirklich" und "Was machen Menschen in der Schweiz damit" in unterschiedlichen Formaten (TV, Radio und Online) nachgegangen. Im zuletzt publizierten Beitrag (18.12.2024) mit dem Titel "Manuelle Berufe werden wegen des KI-Booms wieder beliebter" wird unter anderem eine Studie der Universität Bern vorgestellt, die die Veränderungen in der Berufswahl von Schulabgängern:innen seit der Lancierung von ChatGPT untersucht.
News zum Thema KI, Künstliche Intelligenz, Rubrik Wissen, SRF
Das Institut für Kommunikation und Medienforschung der Universität Zürich, Abteilung Medienwandel und Innovation, hat in Zusammenarbeit mit der SRG eine repräsentative Berfragung unter Schweizer Internetnutzenden (2023: 97% der Bevölkerung) zu ihrem Umgang mit und ihrer Haltung zu Künstlicher Intelligenz durchgeführt. Folgende Ergebnisse haben sich aus der Befragung ergeben:
1. Rasante Diffusion: Eineinhalb Jahre nach Markteinführung kennt die ganze Schweiz KI-Tools, die Hälfte nutzt sie, von den Jüngsten fast alle
Die Nutzung von KI-Tools unter den Schweizer Internetnutzenden ist von 37% (2023) auf 54% (2024) gestiegen. In der jüngsten Altersgruppe (16- bis 29jährige) kennen und nutzen 97% KI-Tools.
2. Digitale Ungleichheiten in der Schweizer Gesellschaft nach Alter und Bildung verstärken sich durch Künstliche Intelligenz
Mit steigendem Bildungsniveau steigt der Anteil der KI-Nutzenden stark (tief: 37%, mittel: 42%, hoch: 70%). Es ist zu erwarten, dass sich die bestehende digitale Ungleichheit in der Schweiz aufgrund der Nutzung von KI-Tools in der Zukunft noch verstärken wird, u.a. auch weil Jüngere und höher gebildete Schweizer Internetnutzende diesen Tools gegenüber optimistischer eingestellt sind.
3. Die Nutzung von KI-Tools ist meist noch experimentell („um zu sehen,wie gut sie sind“)
Neugier, längere Texte verarbeiten, etwas lernen oder Probleme lösen - das sind die meist genannten Gründe für die Nutzung von KI-Tools. Zudem fühlen sich Schweizer KI-Nutzende über alle soziodemografischen Gruppen hinweg relativ wohl im Umgang mit KI-Tools, obwohl diese Dienste erst seit eineinhalb Jahren zur Verfügung stehen und für die Nutzenden eher undurchschaubar sind.
4. Erste Anzeichen einer Sättigung; Fehlerhafte Informationen durchKI-Tools sind der wichtigste Grund für Nichtnutzung
Neben der fehlerhaften Informationserzeugung wird als genauso wichtiger Grund für die Nichtnutzung von KI-Tools der fehlende Zusammenhang zum eigenen Alltag angegeben.
5. Trade-off: Hohe Datenschutzbedenken bei gleichzeitig hohen Erwartungen einer Effizienzsteigerung durch KI
Jüngere Menschen und Männer sind grundsätzlich optimistischer bezüglich dem Einfluss von KI auf unseren Alltag. Ein Grossteil der Befragten glaubt, dass KI genutzt werden kann, um unser Privatleben zu überwachen, aber uns gleichzeitig aber auch helfen wird, Aufgaben effizienter zu erledigen.
6. Die Hälfte steht der KI-Nutzung durch Kinder skeptisch gegenüber, KI-Nutzer*innen, Junge und Männer schätzen es positiver ein
Die Ablehnung von KI-Nutzung durch Kinder wird mit der Auswirkung auf ihre Lernfähigkeit und ihr kritisches Denken begründet. Befürworter argumentieren mit einem erhöhten Interesser für neue Technologien und dem Zugang zu Ressourcen.
7. Gepaltenes Meinungsbild zur Regulierung von KI-Tools
Nur ein Drittel der Befragten glaubt, dass es möglich ist, KI-Tools zu regulieren. Jüngere schätzen diese Möglichkeit optimistischer ein.
8.Schweiz liegt in Kenntnis und Nutzung von KI-Tools vor Tschechischer Republik und Macao
In Bezug auf Wissen und Nutzung von KI-Tools sind die drei Länder in ihren soziodemografischen Mustern vergleichbar.
Michael Latzer, Noemi Festic: «Künstliche Intelligenz» in der Schweiz 2024: Kenntnisse, Nutzung und Einstellungen zur generativen KI, Universität Zürich IKMZ – Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung Abteilung Medienwandel & Innovation, November 2024.
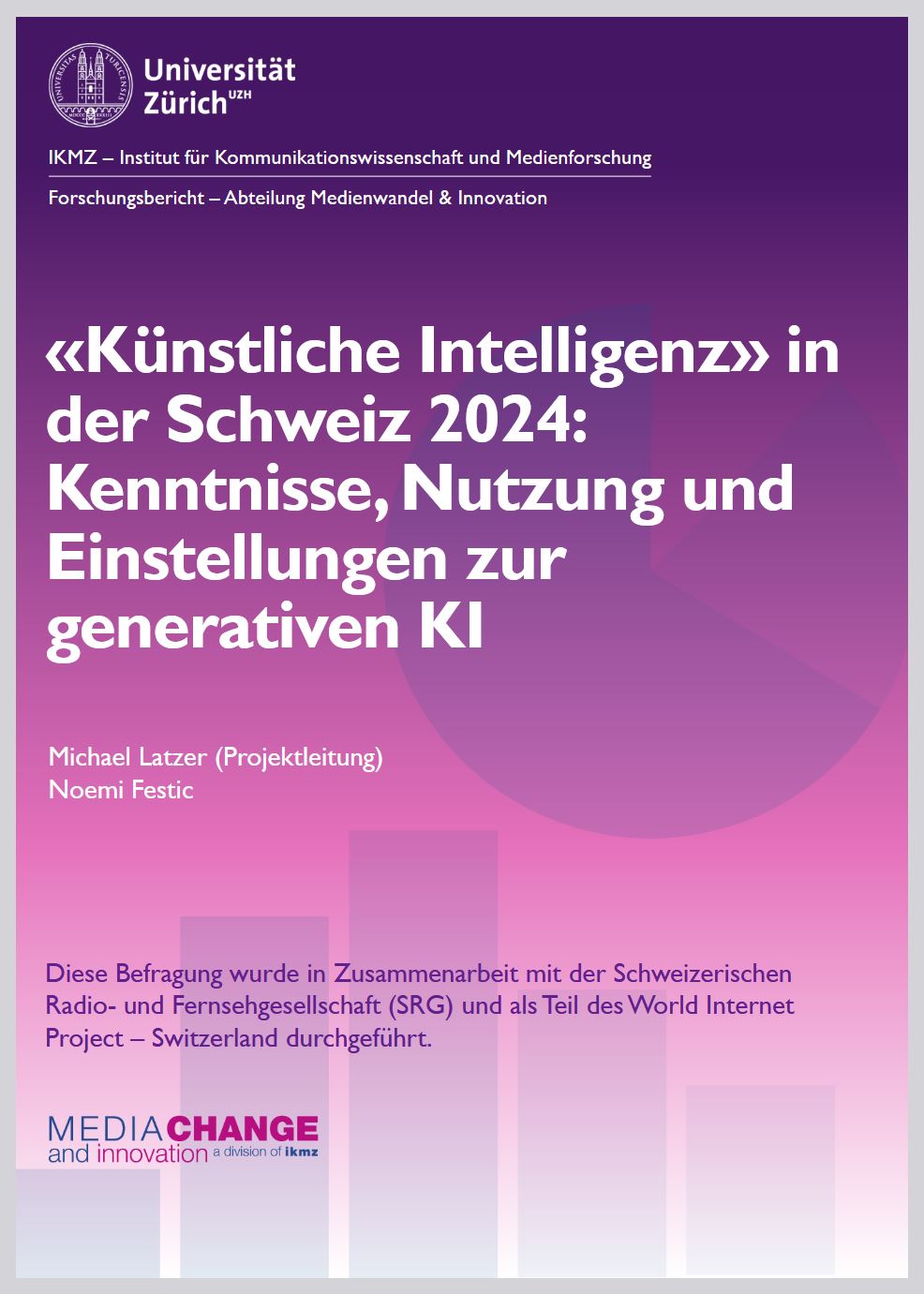
Das Buch Generative Künstliche Intelligenz von Sabine Seufert und Siegfried Handschuh (Herausgeber, beide Universität St. Gallen) mit dem Untertitel ChatGPT und Co für Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft beleuchtet
- Generative KI: Funktionsweise, Stärken und Schwächen
- Chancen und Risiken von KI für Wirtschaft und Gesellschaft
- Mit konkreten Anwendungsfällen aus dem Bildungsbereich
Die Kapitel 9 und 13 (siehe unten) thematisieren Fragen der Bildung.
Inhaltsverzeichnis
I. Orientierung und Grundverständnis
1. Generative KI: Mensch-Maschine-Augmentation Sabine Seufert und Siegfried Handschuh
Einleitung
Industrielle Revolutionen
Entwicklungslinien von Mensch-Maschine-Interaktionen
Augmentation: Zusammenarbeit Mensch-Maschine
Struktur und Aufbau des Buches
2. Große Sprachmodelle Siegfried Handschuh
Einleitung
Architektur großer Sprachmodelle
Die Vorhersage des nächsten Wortes
Emergente Fähigkeiten
Prompt Engineering
Schwächen und Herausforderungen
Aktuelle Entwicklungen
Zusammenfassung
3. Kreativität der generativen KI Gerhard Paass und Dirk Hecker
Generative künstliche Intelligenz
Der kreative Prozess
GAI-Kreativität im sprachlichen Bereich
Erzeugung von Bildern aus Text
Automatische Musikgenerierung
Zusammenfassung
4. Hybride Intelligenz: Zusammenwirken von menschlicher und maschineller Intelligenz Sabine Seufert und Christoph Meier
Einleitung
Hybride Intelligenz als Basis für gelingende Zusammenarbeit von Menschen und smarten Maschinen
Zusammenarbeit mit intelligenten Assistenzsystemen: Formen, Intensitäten, Rollen, Aufgabenteilung
Spezifische menschliche Kompetenzen für die gelingende Zusammenarbeit mit generativer KI
Akzeptanzfaktoren für die Zusammenarbeit mit generativer KI
Zusammenfassung und Ausblick auf Managementaufgaben
II. Management von Innovationen mit generativer KI
5. Chancen und Risiken der generativen KI im strategischen Management Siegfried Handschuh und Christoph Lechner
Was ist generative KI?
Generative KI und strategisches Management
Auswirkungen auf einzelne Bereiche des strategischen Managements
Prompts für das strategische Management
Risiken und Herausforderungen beim Einsatz von generativer KI
Schlussfolgerung
6. Personal- und Kompetenzentwicklung für generative KI in Organisationen Sabine Seufert, Judith Spirgi und Christoph Meier
Einleitung
Neue Ausgangspunkte für die Personal- und Kompetenzentwicklung
Kompetenzentwicklung für den Aufbau und die Nutzung generativer KI in Organisationen
Strategien für die Kompetenzentwicklung im KI-Zeitalter
Zusammenfassung und Ausblick
7. Hybride Innovationsteams – Augmentation menschlicher Innovationsteams mit KI Sebastian G. Bouschery, Vera Blazevic und Frank T. Piller
Einleitung
Von künstlicher Intelligenz zu hybrider Intelligenz
Generative KI und große Sprachmodelle
Hybride Intelligenz und Innovationsteams
Zusammenfassung und Ausblick
III. Auswirkungen auf Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft
8. Zukunft Arbeit: Auswirkungen generativer KI auf den Arbeitsmarkt Patrick Zenhäusern, Stephan Vaterlaus und Katharina Degen
Einleitung
Theoretische Überlegungen zum KI-induzierten Arbeitsmarktwandel
Einfluss von KI in verschiedenen Berufen – Erkenntnisse aus der Schweiz
Regulatorische Handlungsfelder
Ausblick
9. Zukunft Bildung: Auswirkungen generativer KI auf Bildungssysteme Sabine Seufert
Einleitung: KI in der Bildung
Aufbau von Ökosystemen in der Bildung
Ziele: Kompetenzen im Zeitalter der generativen KI
Inhalte: »Flipped Curriculum« – umgedrehtes Curriculum
Organisation und Lernräume: ein Paradigmenwechsel
Assessment: ein doppelspuriges System
Bildungsprozesse mit generativer KI gestalten: Neue Assistenz-, Trainings- und Assessmentsysteme
Zusammenfassung und Ausblick
10. Generative KI aus ethischer Sicht Oliver Bendel
Einführung
Grundlagen generativer KI
Eine ethische Diskussion generativer KI
Ethische Leitlinien
Zusammenfassung und Ausblick
11. Die Regulierung von generativer KI im AI-Act Sebastian Straub
Definition, Grundlagen und Funktionsweise von generativer KI
Zielrichtung und Regelungssystematik des AI-Acts
Regulierungsansätze für generative KI und Basismodelle
Fazit und Ausblick
IV. Anwendungsbeispiele aus der Praxis
12. Hochschulbildung: KI-basiertes Forschen und Schreiben Sabine Seufert, Michael Burkhard, Reto Gubelmann, Christina Niklaus und Siegfried Handschuh
Einleitung
Neue Ausgangspunkte für den Forschungsprozess mit generativer KI
Kompetenzentwicklung mit generativer KI
Anwendungsbeispiele
Zusammenfassung
13. Generative KI in der Lehrerbildung: »Teacher Copilot« als Assistenz- und Trainingssystem für Lehrkräfte Sabine Seufert und Stefan Sonderegger
Einleitung
Neue Ausgangspunkte für die Lehrerbildung
Digitale Kompetenzen von Lehrpersonen im Zeitalter der generativen KI
Teacher Copilot: Assistenz-/Trainingssystem für Lehrpersonen
Erste Pilotversuche und Erfahrungen
Zusammenfassung
14. Fallbeispiel SquirroGPT: Einfach mit Unternehmensdaten »chatten« Dorian Selz
Ausgangslage: Warum es mehr braucht als ChatGPT, um Unternehmensdaten sicher für KI zu verwenden
Retrieval-Augmented Generation
SquirroGPT: Die Unternehmenslösung für GPT
Fazit: Informationsinteraktion neu gedacht
Ausblick
15. Fallbeispiel Legal OS – Nutzung generativer KI für Rechtsfragen im Unternehmen Charlotte Kufus und Stéphanie Aubry
Ausgangssituation: Die Ursprünge von Legal OS
Die Zielsetzung und Funktionsweise von Legal OS
Implementierung und Qualitätsentwicklung von Legal OS in Organisationen
Bisherige Erfahrungen und Ausblick
16. The Introduction of the Generative AI Co-Creator Maarten K. Pieters
Introduction
The co-creative process and the role of participants
The Generative AI Co-Creator
Nine rules for GAICC development
KI-Gesetz der EU
Am 23. März 2024 hat das EU-Parlament den AI Act beschlossen.
Die Inkraftsetzung wird auf Juli 2024 erwartet.
Der "Swiss Finish" wird auf Ende 2024 erwartet.
Das Kernstück des AI Act ist ein risikobasierter Ansatz zur Einstufung von KI-Systemen.
Die folgenden Risikostufen sind mit unterschiedlichen Auflagen versehen:
- inakzeptables Risiko
- hohes Risiko
- begrenztes Risiko
- ohne Risiko
Das KI-Gesetz der EU hat folgende Bedeutung für den Bildungsbereich:
- Der Einsatz von KI-Systemen zur Emotionserkennung von Schüler:innen/Lernenden wird laut Gesetz verboten.
- Das Thema "Digitale Prüfungsunterstützung durch KI" fällt in den Bereich "hohes Risiko", da die KI in der allgemeinen oder beruflichen Bildung den Zugang zu Bildung und den beruflichen Verlauf des Lebens einer Person bestimmen kann (z. B. Bewertung von Prüfungen).
- Generell soll der Einsatz von KI in Bildungseinrichtungen auf Elemente beschränkt werden, die nachweislich die Kompetenzen und sozialen Fähigkeiten der Lernenden erweitern.
- Insgesamt zielt das KI-Gesetz darauf ab, die Grundrechte und den Schutz der Bürgerinnen und Bürger, auch im Bildungskontext, sicherzustellen und Risiken wie Diskriminierung, Manipulation oder Intransparenz durch den Einsatz von KI-Systemen zu minimieren.
Diese Ausgabe der Fachzeitschrift "Frauenfragen" (2024) der eidgenössischen Kommission für Frauenfragen bietet eine Analyse der Chancen und Risiken, die KI und Algorithmen für die Gleichstellung der Geschlechter bieten. Anhand von wissenschaftlichen Artikeln, Interviews, Porträts und Illustrationen umreisst die Zeitschrift die rechliche und gesellschaftliche Situation zur Thematik in der Schweiz.
KI, Algorithmen und Geschlecht, Frauenfragen, EKF 2024.
Im "Atlas der Automatisierung" erhält man einen Überblick, wo in der Schweiz Algorithmen eingesetzt werden und wie diese den Alltag, aber auch die Rechte des Einzelnen und die Gesellschaft beeinflussen können. Dadurch soll Transparenz hergestellt werden, so dass die Öffentlichkeit nachvollziehen kann, welchen Einfluss algorithmische Systeme auf unser Leben haben. Im Speziellen sollen dadurch algorithmische Systeme sichtbar gemacht werden, die in Entscheidungsprozessen und insbesondere von der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden.
Die Datenbank wird laufend ergänzt und beruht auf Recherchen von AlgorithmWatch CH, auf Anfragen an öffentliche Verwaltungen und auf politischen Vorstössen. Der Atlas kann nach Kanton, Anwender:innen, betroffenen Gruppen oder vielen anderen Kriterien gefiltert werden.
Atlas der Automatisierung, AlgorithmWatch, seit 2023
Informationsmaterial zu Datennutzung und Datenschutz
Das Portal zum Thema Datenschutz im Schweizer Bildungsraum wurde 2021 von der Schweizer Fachagentur Educa ins Leben gerufen und seither ständig aktualisiert. Es wird eine Sammlung von Merkblättern, Leitfäden, gesetzlihen Grundlagen und weiteren Inhalten aus allen Kantonen sowie kantonsübergreifenden Quellen zur Verfügung gestellt.
Informationsmaterial zu Datennutzung und Datenschutz, Educa, seit 2021.


